B.
50 Jahre Grundgesetz. Haben wir kein Jahr-1999-Problem?
Stand: 30.9.2000
Demokratie ist nicht gleich Demokratie. Im Geschichtsunterricht haben wir die moderne Form als eine Art Quantensprung in der Evolution der Gesellschaftsformen kennengelernt. Ist unsere deutsche Demokratie das wirklich? Machen wir Deutschen die Demokratie richtig?
Zunächst: Alle Staatsformen laufen Gefahr, die selbst verkündeten Ziele und Leitbilder in der Praxis aus den Augen zu verlieren oder gar als Utopie abzutun.
Mit Freude haben wir über den "real existierenden Sozialismus" gespottet. Aber Hand auf's Herz: Gibt es nicht auch eine "real existierende Demokratie"? Eine Demokratie, die mehr auf Form und Institution achtet als auf Kommunikation und Inhalt? Die ihre Bürger eher fernhält, als sie eng in den politischen Willensbildungsprozess einzubinden?
Geschichtlich bedingt ist unser Staat ausgeprägt "parlamentarisch repräsentativ" (vertretend) aufgebaut. Er kommt auch ohne tiefen Gedankenaustausch mit den normalen, den nicht parteigebundenen Bürgern gut voran. Und in den Parteien ist das Urteil über politische Kernthemen häufig kleinen Gruppen anvertraut. Dann entscheiden sehr wenige für sehr viele. Ich überspitze, um den Punkt klarzumachen: Deutschland ist eine absolute Republik, eine res publica civibus absoluta, eine von den Bürgern losgelöste Republik.
Nun, die historischen Bedingungen dieser Konstruktion - Angst vor in den Nachkriegsjahren weiterwirkenden totalitären und faschistischen Grundeinstellungen der Bürger - sind nun schon seit Jahrzehnten überwunden und die Bürger sind demokratisch volljährig geworden. Spätestens mit der Wiedervereinigung ist auch eine Sollbruchstelle des Grundgesetzes erreicht, das nur ein Provisorium sein wollte, bis sich alle Deutschen eine erwachsene Verfassung geben konnten.
Wie lief die Entwicklung und wo stehen wir heute?
Die Wurzeln
Ist die Bürgerferne des Grundgesetzes eine Vorgabe der Alliierten? Ein netter Erklärungsversuch, aber grundfalsch. Tatsächlich ist die Distanz schlicht hausgemacht. Die Alliierten hatten im sog. "Frankfurter Dokument I" v. 1.7.1948 ausdrücklich ein Referendum zur Annahme des Grundgesetzes durch die deutsche Bevölkerung gefordert:
(...) Wenn die Verfassung in der von der Verfassunggebenden Versammlung ausgearbeiteten Form mit diesen allgemeinen Grundsätzen nicht im Widerspruch steht (Bezug: föderale Struktur mit Sicherung der Rechte der beteiligten Länder, angemessene Zentralinstanz, Garantie der individuelle Rechte und Freiheiten), werden die Militärgouverneure Ihre Vorlage zur Ratifizierung genehmigen. Die Verfassunggebende Versammlung wird daraufhin aufgelöst. Die Ratifizierung in jedem beteiligten Land erfolgt durch ein Referendum, das eine einfache Mehrheit der Abstimmenden in jedem Land erfordert, nach von jedem Land jeweils anzunehmenden Regeln und Verfahren. Sobald die Verfassung von zwei Dritteln der Länder ratifiziert ist, tritt sie in Kraft und ist für alle Länder bindend. (...)
Dies entspricht bestem amerikanischem Verfassungsverständnis und sollte die Identifikation der Bürger mit der neuen Ordnung festigen. Das amerikanische Verfassungsrecht kennt übrigens neben dem Grundsatz der Volks-Verfassung traditionell und weitverbreitet auch die Volks-Gesetzgebung und die Amerikaner haben nach dem Vorbild vieler amerikanischer Teilstaaten direkt-demokratische Regelungen in verschiedenen deutschen Landesverfassungen unterstützt. Gegen die Volksabstimmung über die Verfassung haben sich dann westdeutsche Politiker gewandt. Sie befürchteten, eine "vollgültige" Verfassung könnte ein Hindernis späterer Wiedervereinigung sein und eine Mehrheit der Deutschen könnte das Grundgesetz als Zementierung der deutschen Teilung ablehnen. Und so heißt es in dem deutsch-alliierten Schlusskommuniqué auf der Grundlage der Schlusskonferenz der Militärgouverneure mit den Ministerpräsidenten am 26.7.1948:
1. Der Parlamentarische Rat tritt gemäß Dokument I am 1.9.1948 zusammen und führt die Beratungen über die vorläufige Verfassung der Vereinigten Westzonen durch. Das Ergebnis seiner Beratungen wird den Namen "Grundgesetz - Vorläufige Verfassung" (basic constitutional law) tragen. Die Ministerpräsidenten schlagen die Ratifizierung des "Grundgesetzes - Vorläufige Verfassung" durch die Länderparlamente vor. Sofern die alliierten Regierungen auf die Abhaltung einer Volksabstimmung bestehen, erklären sich die Ministerpräsidenten auch mit dieser Lösung einverstanden.
2. (...)
Die Alliierten haben nicht weiter auf das Referendum bestanden und unmittelbar nach der Konferenz wurde eine Vereinbarung der Ministerpräsidenten über den Parlamentarischen Rat und das "Modell eines Gesetzes über die Errichtung des Parlamentarischen Rates" veröffentlicht. Das Grundgesetz wurde 1949 entsprechend dem Votum der Ministerpräsidenten durch die Landesparlamente (bis auf Bayern) und eben nicht durch die Bürger angenommen. Die damalige Präambel ist in der Interpretation des kleinen Schönheitsfehlers etwas ungenau und recht großzügig; sie zeigt immerhin den richtigen Weg (Hervorhebungen von mir):
Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen (...) hat das Deutsche Volk in den Ländern (...), um dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben, kraft seiner verfassunggebenden Gewalt dieses Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland beschlossen. (...)
Es war ein seltsamer Schwebezustand der noch nicht ganz vollendeten Demokratie- Westdeutschland schon als Bollwerk fest und die Bürger mit dem Versprechen des Provisoriums auf später vertröstet. Da fiel es selbst den Vätern des Grundgesetzes schwer, mit einfachen Worten Verfassungspatriotismus herüber zu bringen:
"Wir begreifen das Wort - provisorisch - natürlich vor allem im geographischen Sinn, da wir uns unserer Teilsituation völlig bewusst sind, geographisch und volkspolitisch. Aber strukturell wollen wir etwas machen, was nicht provisorisch ist und gleich wieder in die Situation gerät: heute machen wir etwas und morgen kann man es wieder ändern, und übermorgen wird eine neue Auseinandersetzung kommen. Wir müssen strukturell vielmehr etwas Stabileres hier fertigzubringen versuchen, auch etwas, das eine gewisse Symbolwirkung hat, sodass wir den Besatzungsmächten, dass wir auch den Leuten im Osten sagen: wir sind nun eben auf einem Weg begriffen, dessen Ende noch nicht erreicht ist."
Diese pragmatische Quadratur des demokratischen Kreises hat Theodor Heuss formuliert, Mitglied des Parlamentarischen Rates und späterer erster Bundespräsident.
Soweit zur Abstimmung der Deutschen über die Verfassung selbst, eine Abstimmung, die nach 50 Jahren noch immer aussteht. Ich kann das auch sehr positiv fassen: als bisher aufgesparte Chance, Legitimation zu schaffen und unseren Staat jetzt in uns Bürgern anzusiedeln.
Ochlophobie / Pöbelfurcht als Klammer
Der Argwohn gegenüber dem Volk ist in Deutschland fest und lang verwurzelt - die Angst vor einer Pöbelherrschaft wirkt als historische Klammer. Ich bin so frei und führe dafür den Begriff Ochlophobie oder Pöbelfurcht ein. Sie reicht herüber aus der Kaiserzeit in eine Demokratie-kritische Haltung der ersten Republik, die spätestens Ende der Zwanziger Jahre wieder stolz und offen getragen wurde. Man kann auch in das damalige europäische Umfeld blicken: Das demokratisch-parlamentarische Prinzip galt in den Dreissiger und Vierziger Jahren auf dem europäischen Kontinent - mit Ausnahme der Benelux-Staaten und Skandinaviens - als endgültig gescheitert.
Hans Mommsen, Alternative zu Hitler, München 2000, S. 8
Der Argwohn gegen die Bürgermenge setzte sich fort in einer elitär-autoritären Tendenz selbst des deutschen Widerstandes. Die weitverbreitete Skepsis gegenüber dem liberal-demokratischen System speiste sich bei den Vertretern des konservativen Flügels (des deutschen Widerstandes) auch aus der Überzeugung, dass Hitler ein Produkt der "Massendemokratie" sei, wobei man das politische Gewicht der nationalsozialistischen Massenmobilisierung bei weitem überschätzte.
Mommsen, aaO S. 165.
Die Vorstellung, Hitler habe den angeblich legalen Durchbruch zur Macht einer "Überdemokratisierung" der Weimarer Reichsverfassung verdankt, brachen noch in den Beratungen des Parlamentarischen Rates durch.
Mommsen, aaO S. 165.
Die Angst vor der Volks-Gesetzgebung, vor Volksinitiative und Volksentscheid in der Hand von Deutschen rührte damit primär von deutschen Politikern und nährte sich aus intensiver Ochlophobie. Wieder kann ich Heuss zitieren:
"Cave canem, ich warne davor, mit dieser Geschichte die künftige Demokratie zu belasten. (...) Das Volksbegehren, die Volksinitiative, in den übersehbaren Dingen mit einer staatsbürgerlichen Tradition wohltätig, ist in der Zeit der Vermassung und Entwurzelung, in der großräumigen Demokratie die Prämie jedes Demagogen."
Diese Einschätzung hat in der damaligen Situation und Gemütslage offensichtlich vorgeherrscht. Bei systematischer Prüfung stellt sich aber heraus: Die direkt-demokratischen Elemente der Weimarer Verfassung haben den Absturz in die Diktatur nicht ausgelöst, nicht einmal begünstigt.
Heußner/Jung [Hrsg.], Mehr Demokratie wagen, Olzog 1999, S. 41 - 57 mit ausführlichen Belegen
Wir dürfen die betont stabile, technokratische und bürgerferne Form des Grundgesetzes - unsere repräsentative Demokratie - getrost als Produkt eines andauernden Argwohns gegen die Bürger begreifen. Ein mutiger Neubeginn mit den Bürgern war es eindeutig nicht. Und dieses Ergebnis hat viel Zynismus. Die totalitäre deutsche Phase mit ihrer Verachtung aller bürgerlichen Rechte hat gerade die Bürger in dauerhaften politisch-moralischen Verruf gebracht - und ihnen die rote Karte bis auf weiteres eingetragen. Ein Gutteil der wirtschaftlichen, kulturellen und staatlichen Eliten dagegen wurde wieder gebraucht und wirkte weiter. Das gilt auch für den deutschen Ostteil. Das nationalsozialistische Kapitel hat damit die Kluft zwischen Bürgern und Staat mit Langzeitwirkung verfestigt.
Andere Länder dagegen haben sehr gute Erfahrungen mit unmittelbarer Einbindung der Bürger gemacht: Direkt-demokratische Strukturen sind auch in größeren Staaten ohne Zweifel erfolgreich und tragen merkbar zum Einklang zwischen Bürgern und Gemeinwesen bei.
vgl. Heußner/Jung, aaO S. 87 - 141, 159 - 236 zu den Erfahrungen in den USA, in der Schweiz und in Italien bzw. zur aktuellen Praxis in den deutschen Bundesländern
Ich empfehle auch die Homepage des engagierten und in mehreren Bundesländern mit diversen Projekten erfolgreichen Vereins "Mehr Demokratie". Dort finden Sie auch interessante internationale links für den Blick über den deutschen Tellerrand.
Das Misstrauen zwischen Politik und Volk war zweiseitig und damit besonders dauerhaft: Die Deutschen waren bis zum bitteren Ende des Krieges mehrheitlich auf eine politische Führungsschicht fixiert, die erst nach der Kapitulation als unmoralisch und verbrecherisch erkannt wurde. Mit der massiven historischen Schuld Deutschlands konfrontiert wollten die allermeisten keine politische Verantwortung übernehmen, betrachteten Politik als ein "schmutziges Geschäft" und machten sich lieber an den physischen Wiederaufbau, einschließlich Fresswelle.
Ein repräsentatives Zeitzeugnis: Erinnerungen eines Schülers, der im Jahre 1951 Abitur gemacht hat:
"Politische Bildung erlebte ich nicht, wohl aber eine wertorientierte. Überhaupt fand eine Unterrichtung zur Demokratie nicht statt und war wohl auch nicht notwendig. Bis auf wenige Unbelehrbare waren vor allem junge Menschen angesichts des Desasters des verlorenen Krieges, des totalen Zusammenbruchs, der zu beklagenden Toten in fast jeder Familie und der Verwüstung unserer Städte über die heimtückische Verführung des Gröfaz (des größten Feldherrn aller Zeiten) und seiner Helfer derart enttäuscht, das sie nichts mehr davon hören mochten." (Zitat aus der Ausstellung Eine höhere Schulzeit in Opladen 1941 - 1951, Villa Römer, Leverkusen, Februar/März 2001)
Eine unpolitische Grundstimmung ist nicht untypisch im Gefolge von System- und Herrschaftswechseln - ein Pawlowscher Reflex, der nach der 1989er Wende im Osten auch die neuen Bundesbürger stark geprägt hat. Ein Ausschnitt, der aber genau unsere Zukunft betrifft: Die im März 2000 in Berlin vorgestellte 13. Shell Jugendstudie berichtet von "teils erdrutschartigen Vertrauensverlusten" der Politik bei der Jugend, und zwar verstärkt bei der Jugend im Osten:
"Das politische Interesse auf Seiten der Jugendlichen sinkt weiter. Das gilt für alle verschiedenen Untergruppen. Es hat zum einen damit zu tun, daß Jugendliche mit dem Begriff Politik die Landschaft von Parteien, Gremien, parlamentarischen Ritualen, politisch-administrativen Apparaten verbinden, der sie wenig Vertrauen entgegenbringen. Zum anderen empfinden Jugendliche die ritualisierte Betriebsamkeit der Politiker als wenig relevant und ohne Bezug zum wirklichen Leben. Zu erinnern ist: Unsere Daten wurden vor jener Kette von Ereignissen erhoben, die inzwischen "Parteispendenskandal" genannt wird. Im Vergleich zur vorhergehenden Studie ist das Vertrauen zu den Institutionen im staatlich-öffentlichen Bereich leicht angestiegen, zu jenen im Bereich der nichtstaatlichen Organisationen deutlich gesunken (Anm. des Verfassers zur Klarstellung: die politischen Parteien werden zum nichtstaatlichen Bereich gerechnet). Schlußlicht sind aber nach wie vor die politischen Parteien. Gerade bei den nichtstaatlichen Organisationen reißen große Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland auf; in den neuen Bundesländern haben sie erdrutschartig an Vertrauen verloren. Die Jugendlichen lassen sie links liegen, weil sie meinen, sie hätten nichts mit ihrem gegenwärtigen und zukünftigen Leben zu tun."
Auszüge aus der Ergebniszusammenfassung und links zur Shell Jugenstudie: hier.
Demokratie mit Patentverschluss: Strammziehen geht schneller als nachgeben
Haben sich denn nach den ersten unsicheren Jahre und insbesondere nach der Wiedervereinigung Verfassung und Bürger aufeinander zu entwickelt? Im Gegenteil. Wenn, dann wurden Bürger- und Menschenrechte im Grundgesetz noch weiter abgebunden, z.B. durch die Notstandsgesetze. Diese standen in direktem Zusammenhang mit dem Kalten Krieg. Sie wurden beschlossen, als sich in der großen Koalition die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit zusammengefunden hatte. Aber nach siegreichem Ende des Kalten Krieges und überstandener Gefahr bekamen die Bürger ihre Rechte nicht etwa zurückerstattet. Das wurde nicht einmal überprüft. Ein Beispiel des Rückbaus von Menschenrechten ist die Asylrechtsnovelle. Wird in einer völligen Fehlreaktion auf rechtsextreme Umtriebe vielleicht jetzt auch das Demonstrationsrecht gekappt?
Bei den Bürgern in Ost und West wächst eine Verbund-Verdrossenheit über Parteien, Politik und Staat, gleichzeitig nimmt das Interesse an Wahlen rapide ab, selbst auf den bürgernäheren Ebenen der Politik, in den Ländern und Kommunen. Der eigenen Mitwirkung wird keine relevante Auswirkung auf die Gestaltung der Lebensverhältnisse mehr zugetraut und der Politik die regelnde Kompetenz abgesprochen. Mit Wahlbeteiligungen von unter 50% muss man sich künftig wohl abfinden. Muss man?
Parlament oder Parlamentarismus?
Wie reformbereit sieht sich das Parlament selbst? Eine doppelt repräsentative Momentaufnahme war der Festakt "50 Jahre Deutscher Bundestag" am 7.9.1999: Repräsentativ, indem die Fraktionsvorsitzenden eine große Zahl von Abgeordneten vertraten und gleichzeitig einen Zeitraum von mehreren Politikergenerationen abdeckten.
Das die Ansprachen beherrschende Thema war Stabilität. Nur Schlauch für die Bündnis-Grünen und Gysi für die PDS forderten neue Wege auf den Bürger zu wie Volksbegehren, Volksentscheid, Mitentscheid der Wähler über Sachfragen und die Mitgestaltung der Rangfolge auf Wahllisten. Der Reform-geneigte Anteil des Bundestages betrüge danach etwa 12%. Zur Verdeutlichung: Für die entsprechende Verfassungsänderung bräuchte es 67%.
Auffallend: Struck und Schäuble fochten energisch - und zwar Schulter an Schulter - für den dem Grundgesetz fremden, aber natürlich die Praxis beherrschenden Fraktionszwang und gegen die - im Grundgesetz verbriefte, gleichwohl völlig untergeordnete - Gewissensfreiheit der Abgeordneten. Struck formte geradewegs eine moralisch motivierte Vermutung für den Fraktionszwang:
"Ich finde, jeder von uns, der sich auf seine Gewissensfreiheit beruft, muss sich selbst die Frage (Carlo Schmidts) gestellt haben: Ist denn sicher, dass gerade ich recht habe, wenn vier Fünftel meiner Fraktion der Meinung sind, ihre Vorstellung von der Sache sei besser als meine?"
Schäuble pflichtete erfreut bei und fügte treuherzig hinzu, das mit dem Gewissen solle man nicht dramatisieren; es ginge halt um "unterschiedliche Meinungen, Interessen, Verpflichtungen und Rücksichtnahmen" (!), aber nur im absoluten Ausnahmefall um Gewissensfragen: "Wenn jeder nur das macht, was er will, bekommen wir keine Mehrheiten, haben wir keine stabile (!) Demokratie und die Freiheit der Bürger ist weniger sicher." Und Gerhardt lag sehr daran, im Namen der FDP eindrücklich vor den "theoriesüchtigen Intellektuellen" zu warnen, deren "Heilsbotschaften (...) in der Geschichte niemals anders als in der Unterdrückung geendet haben." Will sagen: Keine Utopien mehr! Glos sekundierte noch für die CSU: "Das Parlament muss frei entscheiden können; es darf keine Pressionen der Straße geben!" Waren damit wir Bürger gemeint? Unter diesen wohl eher die Ärmeren als die Reicheren. Die Pöbelfurcht regiert.
Es ist kaum ein Zufall: In den Ansprachen zum 7.9.1999 wurden die Bürger als demokratische Mitspieler oder gar als politische Impulsgeber nur ganz selten genannt, nur von Bündnis-Grünen und PDS. Dafür fiel umso häufiger der Begriff des Parlamentarismus. Was ist das? Unsere Sprache kennzeichnet mit "ismen" regelmäßig die Übermaß- oder Übertreibungsform wie etwa den "Fundamentalismus". Die "ismen" werden üblicherweise an Gruppen oder Überzeugungen geheftet, die selbstgewiss, verhärtet und reformfeindlich verharren. Haben wir mit dem überzeugten Parlamentarismus eine parlamentaristische, vielleicht sogar repräsentativistische Demokratie?
Zum Genießen noch zwei Zitate aus der Lehre - mit Kernelementen der Parlamentarismus-Philosophie:
"Ganz allgemein stellt sich die Frage, ob das zunehmende Komplizierterwerden der politischen Probleme und damit auch der politischen Entscheidungen nicht überhaupt weitgehend den intellektuellen Rahmen sprengt, der Voraussetzung echter politischer Entscheidungen durch das Staatsvolk ist."
Die Hervorhebungen stammen vom zitierten Autor. Meine Anmerkung: Also in klareren Worten, das Staatsvolk ist zu blöd. Dann müssen die Schweizer einer weit überlegenen Spezies angehören: Mit direkter Demokratie auch zu Steuerfragen haben sie sich für eine Arbeitslosigkeitsrate von unter 4 % entschieden. Und entgegen allen Gerüchten besteht die moderne Schweiz nicht lediglich aus einer großen Alm mit einer Bank, ein paar Alphörnern und vielen blauen Kühen.
Es lohnt auch daran zu erinnern: Die Bede - die Steuerbitte der Fürsten an die Stände - ist eine der wesentlichen Wurzeln der mitteleuropäischen Demokratie. Die, die die Zeche zahlen, sollten an der Bestellung mitwirken. Zumeist senkt dieser gute Brauch die Kosten. Ich räume ein, der Gedanke ist heute etwas verschüttet.
Bede [mhd.] die, -/-n, mlat. petitio, die vom 13. bis 17. Jh. durch den Fürsten von seinen Landständen zunächst erbetene, bald aber geforderte außerordentliche Vermögenssteuer, auch Schatzung, Schoss, Gewerf genannt. Als Grund-, Gebäude- oder Viehsteuer traf sie praktisch nur die Bürger und Bauern. In den Städten bildete sich eine besondere Beziehung zwischen Bede-Zahlung und Bürgerrecht heraus: Wer die Bede nicht zahlte, verlor das Bürgerrecht. Umgekehrt konnte das Bürgerrecht durch Zahlung der Bede gewonnen werden. Daneben gab es Notbeden als außerordentliche Steuern, z. B. zur Aussteuer einer Tochter (Fräuleinsteuer) oder zur Auslösung des Landesherrn bei Gefangenschaft
WAAS: Vogtei u. Bede, 2 Bde. (1919-23); THEODOR MAYER: Gesch. der Finanzwirtschaft vom Mittelalter .bis zum Ende des 18. Jh., in: Handbuch der Finanzwissenschaften, Bd. 1(1952).
Entnommen aus: Brockhaus Enzyclopädie, 20. Aufl. Mannheim 1996
Eine Anmerkung: Im Zuge des Partei-Spendenskandals sollte man die - auch offizielle - Wiedereinführung der Notbede erwägen; Altbundeskanzler Kohl hat mit seiner Wiedergutmachungs-Spendenkampagne des Jahres 2000 bereits Zeichen gesetzt. Nun das 2. Zitat:
"Verfassungstheoretisch handelt es sich (bei der vom Autor postulierten rechtlichen Freistellung des Parlaments von der Bindung an den unmittelbaren Volkswillen) um (...) eine hochmoderne Antwort auf das oben schon angesprochene Problem, dass die heutigen politischen Probleme sich infolge ihrer zunehmenden Komplexität der Beurteilung durch den einfachen Aktivbürger immer mehr entziehen und dass eine Politik, die in 50 oder 100 Jahren auch vor dem Auge der dann lebenden Generation noch Bestand haben soll, heute u.U. auf sehr wenig Verständnis stößt und daher ggfs. auch gegen, zumindest aber ohne die Zustimmung der heute lebenden Menschen durchgesetzt werden muss."
Wer ist's, der da die Politiker als weise Seher und kühne Vollstrecker würdigt, hart gegen sich und andere? Die Zitate stammen aus dem mit Abstand angesehensten Kommentar zum Grundgesetz, dem Großkommentar Maunz/Dürig. Bearbeiter der zitierten Passagen unter den Randnummern II 41 und II 64 zu Art. 20 des Grundgesetzes ist Roman Herzog, ehemals Präsident des Bundesverfassungsgerichts, später deutscher Bundespräsident. Der dann allerdings nach fünf Jahren Praxis als erster Bürger wesentlich mehr Bedarf an fühlbarer Demokratie sah.
Und noch ein programmatisches Zitat:
"Politisches Handeln darf nicht bestimmt sein von der kurzfristigen Befriedigung von Einzel- oder Gruppeninteressen, deren Summe nicht schon das Gemeinwohl ergibt, sondern muss geleitet sein von der dauerhaften Gesamtverantwortung für unser Volk. Nur so kann es auch den Belangen von nicht organisierten Gruppen und der zukünftigen Generationen gerecht werden. Eine verantwortungsvolle Politik muss notwendige Entscheidungen auch gegen Widerstände in der öffentlichen Meinung zu treffen bereit sein."
Diese Passage weist einige Anklänge zu den vorhergehenden Zitaten auf; sie stammt aus dem Grundsatzprogramm "Freiheit und Verantwortung", beschlossen auf dem Parteitag der CDU am 23.2.1994 in Hamburg (Zf. 109). Konkret aufgeschrieben hat's hier einmal die CDU, aber das daraus sprechende obrigkeitliche, manchmal auch fürsorglich eingekleidete Denken ist in praktisch allen Parteien anzutreffen. Es sagt: Wir kennen die notwendigen Entscheidungen naturgemäß besser als die Betroffenen selbst. Es drückt den noch heute verhaltenen Schrecken aus über die erst vor historisch kurzer Zeit (von der Arbeiterbewegung) durchgesetzte Erstreckung des aktiven Wahlrechtes auf alle Teile der Bevölkerung. Ein Schrecken, der die Demokratie weiterhin als sorgsam zu dosierendes Wagnis beargwöhnt - und Bürger zu Mündeln macht statt zu Vertretenen.
Kommt es auf den Punkt, so trauen selbst die Grünen ihrem theoretischen Mut nicht reagieren in hergebrachter Weise Regenten-Rollen-konform. Als Verheugen im September 2000 vorsichtig auf das demokratische Defizit bei der Gestaltung der Europäischen Union hinwies, kommentierte Außenminister Fischer :
"Das ist nicht die Position der Bundesregierung. Allein die Vorstellung, dass wir eine Volksabstimmung über den Beitritt Polens zur EU abhalten, das muss man sich mal zu Ende bedenken."
Herzog war am Ende seiner Amtszeit als Bundespräsident nachdenklicher und kämpferischer geworden: im Rahmen des Staatsaktes "Fünfzig Jahre Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland" am 24.5.1999 hatte er den Blick gegenüber der oben zitierten Kommentierung im Maunz/Dürig mit frischem Mut erweitert:
"Mit Reden und Dozieren ist es dabei (Anknüpfungspunkt: bei der klugen und phantasievollen Ausfüllung des Begriffs Freiheit) nicht getan. Auch die Demokratie muss, wenn ihr Wert vermittelt werden soll, spürbar sein, ja wieder stärker spürbar werden. Ich kann mir beispielsweise durchaus mehr direkten Einfluss der Bürger vorstellen, etwa das Kumulieren und Panaschieren der Wählerstimmen auch bei Bundes- und Landtagswahlen (!), die Ausweitung der Direktwahl von Bürgermeistern, die Verstärkung von Bürgerbegehren, zumindest (!) auf kommunaler Ebene. Gerade auf der Ebene der Nachbarschaften ist der Bürger ja in besonderem Maße zur Übernahme von Verantwortung bereit. Dort können sogar "Frühwarnsysteme" für gesellschaftliche Entwicklungen entstehen, die ein nur auf die Stimmen von Bürokratien und Verbänden hörender Staat (!) leicht übersieht."
Ihm ist es offenbar nach seiner Erfahrung im höchsten Staatsamt sehr daran gelegen, die Schnittstelle zwischen Politik und Bürger durchgängiger und lebhafter zu gestalten. Der Begriff "Frühwarnsystem" mag aus Sicht des Bürgers hier etwas schief und als Nachhall eines sehr obrigkeitlichen Staatsverständnisses klingen; der Bürger versteht sich ja ungern als latente Gefahr. Aber die Wortwahl macht doch das Interesse an direkter, unvermittelter Information und Kommunikation ganz klar.
Einen zum Jubiläum des Bundestages nachdenklich stimmenden Aspekt führte am 7.9.1999 die Gastrednerin ein, Dr. Najma Heptulla, Präsidentin der Rates der Interparlamentarischen Union und Vizepräsidentin des Indischen Oberhauses. Sie forderte die Demokratisierung der internationalen Organisationen. Allen voran der Vereinten Nationen, die mehr werden müssten als eine bloße Veranstaltung von Regierungen. Schäuble winkte gleich ab: Er glaube nicht, dass "wir die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ebenen staatlicher oder öffentlich-rechtlicher Körperschaften in erster Linie durch Parlamente organisieren können." Das ginge in Deutschland wie in Europa nicht und weltweit wohl erst recht nicht. Dies führt aber gleich auf einen anderen, noch wesentlich kritischeren Punkt: Im Rahmen von Internationalisierung und Globalisierung gehen immer mehr Entscheidungsfelder an überstaatliche und zwischenstaatliche Instanzen und zunehmend auch an den nicht-öffentlichen Bereich "verloren". Und zwar ohne dass dort mindestens die gleiche demokratische Teilhabe gewährleistet würde wie in den nationalen Parlamenten. In der Konsequenz müsste das Parlament wegen ausgehender Zuständigkeit und Kompetenz eigentlich kontinuierlich schrumpfen - zumal die Bürger ja auch die neu hinzutretenden übernationalen Institutionen brav finanzieren.
Und ein letztes Mal zurück zum 7.9.1999, zu 50 Jahren Grundgesetz und nun zur Politikverdrossenheit. Schäuble glaubt nicht, dass das Interesse der Bürger am Parlament abnähme. In der Feierstunde präsentierte er für diese frohe These ein beinhartes Indiz. Der Fernsehkanal "Phoenix" habe seine höchsten Einschaltquoten gerade bei Debatten des Bundestages! Ich muss gestehen: Ich weiß nicht, womit der Bundestag in diesem Programm konkurriert. Interessant ist Schäubles aufatmende Folgerung: "Wir brauchen nicht zu resignieren." Das jetzt ist mehrdeutig und könnte heißen:
(1) Wir müssen nicht zurücktreten - oder -
(2) wir müssen das Volk noch nicht ganz abschreiben - oder -
(3) wir können uns weiter beherzt gegen alle Reformen stemmen.
Was genau kann er meinen bzw. was verspricht er für den Fall, dass der Bundestag bei Phoenix mal nicht mehr den Quotenbringer macht?
Und noch'n Zitat, mit Hervorhebungen von mir:
"Wir sind uns alle der tragischen Folgen bewußt, die daraus entstanden sind, dass vor ... Jahren das deutsche Volk die Aufgabe und die Verpflichtung des deutschen Parlaments nicht verstanden hat. Erst die unheilvolle und unbegründete Distanzierung zwischen Parlament und Volk, die trotz vieler ehrlicher Bemühungen damals nicht hinreichend überwunden werden konnte, hat es gewissenlosen Demagogen möglich gemacht, die Herrschaft in Deutschland an sich zu bringen und unser ganzes Volk in ein namenloses Unglück zu stürzen. Es ist an uns allen, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, durch die Darstellung unseres Wollens und durch unsere Arbeit daran mitzuwirken, dass heute eine andere innere Verbindung zwischen Volk und Parlament wächst und die Bürger unseres Staates ein tragfähigeres Verhältnis zu dem von ihnen gewählten Parlament gewinnen."
Für die innere Verbindung zwischen Bürgern und Parlament und gegen Ochlophobie wirbt hier Hermann Ehlers, in seiner Antrittsrede als Bundestagspräsident am 6. Oktober 1953.
Demokratie, Komplexität und Führungsanspruch: Fraktionszwang als interne Repräsentativität des Bundestages
An dieser Stelle lohnt sich, einmal zwei Meter zurückzutreten, um aus der Bürgerperspektive Sinn und Nutzen des Fraktionszwanges breiter zu betrachten. Der Fraktionszwang sichert die Machtbasis der hier zu Wort gekommenen Fraktionsvorsitzenden. Aber der Fraktionszwang ist zum Wortlaut des Grundgesetzes dissonant und Demokratie-theoretisch alles andere als trivial. Der Fraktionszwang ist die nächste Integrationsstufe der repräsentativen Demokratie. Nicht 669 Abgeordnete entscheiden, sondern eine nochmals um den Faktor 100 kondensierte Gruppe der Bürger innerhalb der (Regierungs-) Fraktionen. Und diese Spitze kann ihrerseits unbemerkt oder ganz offen durch die von Schäuble genannten "Interessen, Verpflichtungen und Rücksichtnahmen" gesteuert sein. Es sind in den Kernfragen ganz wenige, die entscheiden. Und es sind nicht notwendig die Gewählten, die den Ausschlag geben, sondern vielleicht auch andere Eliten. Wenn ich ehrlich bin: Dies kann ich mit Geist und Ziel des Leitbildes Demokratie kaum in Einklang bringen, höchstens mit eher undemokratischen pragmatischen Erwägungen.
Kein Trost, sondern eher erschreckend konsequent ist, wie offen sich das Komplexitätsargument in das Parlament hinein fortsetzt und auch die Position und Mitwirkung der Abgeordneten in straffe Hierarchien einbindet. Es lohnt, den meist überblätterten Aufsatz von Carl-Christian Kaiser zu lesen. Kaiser leitet als kritischer Kenner und täglicher Beobachter des parlamentarischen Geschehens (Vorwort) das traditionsreiche Handbuch mit Kurzbeschreibungen der Abgeordneten ein - den weitverbreiteten Kürschner. Die Hervorhebungen in den folgenden Auszügen stammen von mir; zitiert ist nach der ersten Fassung der 14. Wahlperiode (Jan. 1999):
"Das weitverzweigte Netz der Gremien zeigt an, wie kompliziert Politik geworden ist. Die Fraktionen sind auf die Vorarbeit und den Rat ihrer Arbeitskreise, in denen ihre jeweils sachverständigen Abgeordneten versammelt sind, ebenso angewiesen wie später das Plenum auf die Empfehlungen der Bundestagsausschüse. Dies gilt schon deshalb, weil die Fraktionen im allgemeinen gar nicht genug Zeit haben, um sich mit der fast unübersehbaren Fülle der verschiedenen Fachprobleme ausgiebig zu befassen. Vor allem kann nicht jeder der 298 sozialdemokratischen, der 245 christlich-demokratischen bzw. christsozialen Abgeordneten, der 47 Grünen, der 43 freidemokratischen und der 36 Parlamentarier der PDS auf jedem Gebiet zu Hause sein." (S. 11f) "Liegt der Schwerpunkt der Sacharbeit bei den Ausschüssen und den Arbeitsgremien der Fraktionen, so die politische Führung und Koordination bei deren Spitzen. In dem von Diskussion, Aufgabenteilung und auch von einer hierarchischen Ordnung bestimmten inneren Gefüge des Bundestages sind sie ihrerseits wichtige, oft ausschlaggebende Schaltstellen. Die Empfehlungen der Leitungsgremien sind für die Entscheidungen der Fraktionen häufig bestimmend und von großem Einfluss." (S. 14) "Dass es (in der Fraktion) einen, formell oder informell, kleinen und einen größeren Führungskreis gibt, hat verschiedene Gründe. Auf der einen Seite darf das Gremium, das die täglichen Entscheidungen zu fällen hat, nicht zu ungefüge sein. Auf der anderen Seite sollen im Vorstand möglichst alle Gruppierungen in der Fraktion repräsentiert sein." (S. 15) "Grundsätzlich sind alle Mitglieder des Bundestages gleichgestellt. Aber aus ihren verschiedenen Aufgaben ergeben sich doch Unterschiede in ihren Rechten und Pflichten und auch in ihrem politischen Einfluss. Auch diese Hierarchie ist teils sichtbar, teils unsichtbar." (S. 16)
Packend wird die Einordnung der Abgeordneten in Kaisers Aufsatz mit einem "Stundenbuch" illustriert. Es stellt die Tagesroutine eines gewöhnlichen Mitglieds des deutschen Bundestages sehr abschreckend dar - Käfighaltung mit Hamsterrad. Es lohnt sich sehr, das komplette Stundenbuch nachzulesen. Ich zitiere hier einen kurzen Ausschnitt:
"Nach der Beendigung der Aussprache im Plenum kehrt Frau A. in ihr Büro zurück. Sie muss endlich ein paar dringende Briefe diktieren, wiederum stehen einige Besucher ins Haus, aber im Plenum ist die Tagesordnung noch nicht abgehandelt. So schaltet Frau A. den Fernseher ein, über den die Parlamentsdebatte in ihr Büro übertragen werden kann, und teilt ihre Aufmerksamkeit zwischen Briefdiktat und Besuchern hier und der Debatte dort. Schließlich schrillt eine Klingel, die sie zu einer Abstimmung über einen wichtigen Tagesordnungspunkt ins Plenum zurückruft." (S. 31)
Nach dem Klingel-Alarm geht es nicht selten grotesk weiter. So hörte ich von einem Abgeordneten plastisch beschrieben:
"Abgehetzt fragt man an der Türe den Saaldiener, der die Abgeordneten gut kennt: 'Was brauchen wir heute?' 'Zwei blau, einmal weiß!' sagt der gute Mann und hat die Karten auch schon bereit." Anmerkung: Abstimmungskarten gibt es für persönliche Abstimmungen, und zwar in den Farben bleu - blanc - rouge entsprechend Zustimmung, Enthaltung oder Ablehnung. Bei den normalen Abstimmungen durch Handzeichen, Aufstehen/Sitzenbleiben oder notfalls Hammelsprung "orientiert man sich in aller Regel am Stimmführer der Fraktion".
Hier erkennt man nicht den herausgehobenen Bürger, der souverän und gewissenhaft über die Kernfragen des Gemeinwesens mitentscheidet. Eher klingt es so, als ob ein sehr bedauernswerter, atemloser Mensch in einem kaum organisierbaren Arbeitsprozess den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen kann, nur kleine Ausschnitte der relevanten Realität präsentiert bekommt und deshalb auf hierarchische Vorgaben und Richtungsentscheidungen dringendst angewiesen ist.
Das erstens Teilen und zweitens Befehlen ist die bewährteste Herrschaftstechnik. Sie wird perfekt durch den von Alexis de Tocqueville formulierten Befund: die Einsamkeit sei dem Menschen noch viel unerträglicher als der Irrtum. Strucks oben zitiertes Lob des Fraktionszwanges war daher so nötig nicht. Die Suche nach Deckung in der Gruppe ist ohnedies die etwas wahrscheinlichere Verhaltensform des homo politicus. Eher sollte man den Mut eigener Meinung belohnen, den Mut, der auch Neues und Kreatives in den Blick bringt.
Postenwirtschaft
Die Abgeordneten sind gleich. Gleich bezahlt werden sie deswegen aber noch lange nicht. In Thüringen beispielsweise konnten neben den Fraktionsvorsitzenden auch die parlamentarischen Geschäftsführer, die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und die Ausschussvorsitzenden in den Genuss ansehnlicher Zulagen kommen - in Höhe von 40% der Grundentschädigung. Einige "normale" Abgeordete aus der Fraktion "Neues Forum/Grüne/Demokratie jetzt" fanden das nicht lustig und klagten. Das Bundesverfassungsgericht gibt ihnen in einer aktuellen Entscheidung im Wesentlichen Recht. Es betont das Recht aller Abgeordneten auf gleiche Teilhabe am Prozess der politischen Willensbildung und untersagt großzügige und weitgespannte finanziellen Zulagen an Mitglieder der Fraktion, und zwar ganz klar, um finanzielle Abhängigkeiten, sachfremde Einflüsse und Hierarchien innerhalb des Parlaments zu beschränken: "Das auf Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG fußende Freiheitsgebot des Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG verlangt, die Abgeordneten in Statusfragen formal gleich zu behandeln, damit keine Abhängigkeiten oder Hierarchien über das für die Arbeitsfähigkeit des Parlamentes unabdingbare Maß hinaus entstehen. Um eine der Freiheit des Mandats und der Statusgleichheit der Abgeordneten entsprechende, von sachfremden Einflüssen freie politische Willensbildung zu gewährleisten, ist die Zahl der mit Zulagen bedachten Funktionsstellen auf wenige politisch besonders herausgehobene parlamentarische Funktionen zu beschränken."
Bundesverfassungsgericht, 2. Senat, Entscheidung vom 21.7.2000, Az. 2 BvH 3/91; Leitsätze 2, S. 2 und 3; Gründe C I Nrn. 3, 4.
Das Bundesverfassungsgericht bringt es auf den Punkt: "(Es ist) der Gefahr zu begegnen, dass durch die systematische Ausdehnung von Funktionszulagen 'Abgeordnetenlaufbahnen" und Einkommenshierarchien geschaffen werden, die der Freiheit des Mandats abträglich sind und die Bereitschaft der Abgeordneten beeinträchtigen, ohne Rücksicht auf eigene wirtschaftliche Vorteile die jeweils beste Lösung für das Gemeinwohl anzustreben."
Bundesverfassungsgericht, aaO, Gründe C I Nr. 4 lit. b).
Der Bundestag war im Verfahren angehört worden und hatte die fraglichen Funktionszulagen als verfassungsgemäß und völlig üblich bewertet: Mit ihnen würde lediglich "eine außerordentliche Verantwortung und Inanspruchnahme honoriert." Der Parteispenden-Skandal und das dabei erkennbar gewordene Belohnungssystem macht die Brisanz von Geldleistungen für die Wirksamkeit der repräsentativen Demokratie deutlich; siehe auch unten "Big, big Bimbes". Im Parteispenden-Skandal geht es (auch) um verdeckte Zuwendungen an Politiker, hier um offene. Brisant ist aber eben auch die offene Variante, das Bundesverfassungsgericht zeigt es deutlich auf. Auch attraktive 'Abgeordnetenlaufbahnen' können Unterordnung, Abhängigkeit und tendenzielle Entscheidungen fördern - mit einem Wort: Filz.
Lobby: Organisierter Pluralismus siegt besser als 1338 Augen
Die 669 Abgeordneten repräsentieren nicht nur eine jeweils große Anzahl von Bürgern - und diese sollten prinzipiell mit gleichen Chancen vertreten sein - die 669 Abgeordneten verkörpern auch ein 1338-Augen-Prinzip, das Macht auffächern und kontrollieren soll. Wo Macht stark hierarchisch gehandhabt wird, wird der Einfluss auf wenige zu einem wirksamen Transmissionsriemen. Man kann damit einen ganzen Staat an der Nase herumführen. Die Qualität dieses Einflusses ist keinerlei Geheimnis. Mit dem 'Wissenschaftspreis für Arbeiten zum Parlamentarismus' (da ist er ja wieder) wurde im Jahre 1998 die Lobbyismus-Studie von Martin Sebaldt mit dem Titel "Organisierter Pluralismus" ausgezeichnet (Westdeutscher Verlag, Opladen 1997); Sebaldt schreibt in seinem empirisch eingehend belegten Werk etwa:
Lobbyisten und politische Entscheidungsträger profitieren von einer derart ausgeglichenen Beziehungsstruktur gleichermaßen; vielfach bekommt sie sogar symbiotischen Charakter, jeder ist auf den Partner angewiesen: Der Verbandsvertreter benötigt die Macht des politischen Akteurs, dieser aber die Informationen und die Schützenhilfe des Lobbyisten (S. 374). Auf der Alltagsebene entwickeln sich dabei durchweg recht stabile und verlässliche Arbeitsbeziehungen (ebenda). Das inoffizielle Wirken wird dem offiziellen - weil effektiver - durchweg vorgezogen (S. 378).
So wertet nicht etwa nur Lieschen Müller; dies war wie gesagt ein vom Bundestag preisgekrönter Wissenschaftler nach umfassender Recherche vor Ort.
Sebaldt würdigt auch das eingespielte Verhältnis zwischen den Verbänden und den Medien (S. 370ff). Ziehen wir in Betracht, dass auch Medien und Politik beständig Leistungen und Dienste - Information gegen Publizität - austauschen, so ergibt sich ein symbiotisches Dreieck und mit dem vierten (oder ersten) relevanten Mitspieler, der Wirtschaft, ein symbiotischer Raum - ein Kernelement der realen politischen Willensbildung. Anmerkung: Das Miteinander von Wirtschaft, Politik und Presse war offenbar auch aktiv im aktuellen Parteispendenskandal. Die F.A.Z. berichtete am 3.2.2000 über den Pressevertrieb Hannes Müller, den langjährigen Haupt-Spendensammler der CDU:
"Seine Mitarbeiter verkauften Unternehmensanzeigen in CDU-nahen oder im Eigentum der CDU stehenden Zeitschriften an gebefreudige Unternehmen - ein Vorgang, der schon in den Zusammenhang der Spendenaquisition gehört."
Korruption und insbesondere Finanzflüsse zwischen Wirtschaft, Lobby und Politik erwähnt Sebaldts Lobbyismus-Studie nicht. Bei der feierlichen Verleihung des "Wissenschaftspreises des Deutschen Bundestages für Arbeiten zum Parlamentarismus" am 12.3.1998 wurde das Thema nur gestreift; es herrschte der Eindruck vor, dass Lobbyismus eine ganz unspektakuläre, eingefahrene Praxis der Versorgung der Politik mit Sachinformationen sei und bei den Lobbyisten allenfalls ein - allerdings strategisch höchst wichtiger - Vorteil der frühzeitigen Information durch Insider herausspringe. Immerhin bemerkte der zum Preiskomitee gehörende Prof. Dr. Ulrich von Alemann, nachdem er die Flick-Affäre als "böse, aber sicherlich große Ausnahme" eingeordnet hatte, sehr hellsichtig:
"Aber leider ist es ja mit der Korruption und mit solchen schwarzen Erscheinungen so, dass die erfolgreichsten Praktiken nie herauskommen. Insofern weiß man nicht, ob es vielleicht irgendwo noch eine Flick-Affäre gibt, gegeben hat oder noch geben wird." (Protokoll der Verleihungs-Sitzung, S. 22)
Wie wir heute wissen, gab es sie auch im Jahre 1998 sehr intensiv. Bemerkenswert sind ferner die Stellungnahmen von Dr. Peter Spary in der gleichen Sitzung. Spary war von Capital zum "Cheflobbyisten des Mittelstandes" ernannt worden, was er als besonders hohe Auszeichnung ansah, "vergleichbar dem Handwerkszeichen in Gold". Er blickte im Jahre 1998 bereits auf 34 Jahre als Interessenvertreter zurück, davon 26 Jahre innerhalb der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und 23 Jahre als angestellter Geschäftsführer für den Mittelstand (Protokoll S. 18). Für Spary waren alle Probleme der Parteifinanzierung durch Offenlegung der Spenden ein für allemal vom Tisch:
"Seit das in der Bundestagsdrucksache öffentlich gemacht worden ist, interessiert sich noch nicht einmal mehr ein Journalist für diese Thematik, weil es da nichts Spektakuläres gibt. Auch wenn ein einzelner Abgeordneter Wahlkampfhilfe bekommt, muss er Transparenz gelten lassen, sonst zieht ihm die Präsidentin die Ohren lang. Diese Transparenz ist absolut gewährleistet." (Protokoll S. 23).
Spary betonte noch mit einigem Stolz, dass seine Arbeit aus guter Erfahrung auf hoher Ebene ansetzt:
"Wir setzen mehr auf den Kontakt zum Politiker als zum Ministerialbürokraten, weil der Politiker die Richtung angibt. Es hat sich mehr und mehr herausgestellt, dass die wichtigen Gesetzgebungsvorhaben eben nicht von den A-16- oder B-3-Leuten gemacht werden, sondern von Politikern, die die Richtung angeben; die anderen formulieren das dann intelligent aus. Die bringen dann die Verordnungen und die Kommentare dazu auf den Markt, was auch eine sympathische Nebenbeschäftigung ist." (Protokoll S. 19)
Die übrigen Beteiligten hatten Lobbyismus mehrheitlich als eher unspektakuläre, gut geregelte Erscheinung auf der Arbeitsebene geortet, u.a. deswegen, weil die Kontaktpartner nach ihrer Einschätzung fast nur der Administration angehörten, nicht der Politik, insbesondere nicht der höheren Politik. Anm.: Dann freilich hätten sich die Lobbyisten nach einer neuen Gattungsbezeichnung umsehen müssen: Lobby ist von alters her die Wandelhalle des Parlaments, nicht der Bürokratie. Aus heutiger Sicht zu bagatellisierend ist auch die zusammenfassende Darstellung der Sebaldt-Studie auf der Homepage des Bundestages. Völlig einig war man sich am 12.3.1998 immerhin: Es läuft für den am besten, der alle Fäden in der Hand hält:
"Wenn Sie eine bestimmte Entwicklung befürchten oder wissen, dass da was in der Regierung läuft, und Sie wollen, dass das auf den Tisch kommt: Dann brauchen Sie einen Abgeordneten, der eine Anfrage stellt... Optimal ist es natürlich, wenn Sie dem Abgeordneten die Frage schreiben und dem Staatssekretär die Antwort. Dann haben Sie Ihr Geld für den Monat verdient!" (Sebaldt S. 355 unter Zitat eines Gesprächs im Rahmen seiner Feldstudie, Protokoll S. 12).
Die Preisverleihung am 12.3.1998 stand unter dem Motto: "Der Abgeordnete im Visier der Verbände. Mythos und Realität des Lobbyismus im Parlament". von Alemann wies in diesem Zusammenhang auf eine besonders langfristig angelegte Austauschbeziehung zwischen Parlament und Verbänden hin, die auch nicht für eine unabhängige Ausübung des Mandats spricht:
"Herr Spary hat das mit der nachparlamentarischen Karriere von manchen Abgeordneten angedeutet, die in Verbänden ihr Auskommen finden. Es ist also vielleicht umgekehrt: Nicht der Abgeordnete sitzt im Visier der Verbände, sondern die Verbände sitzen im Visier der Abgeordneten für eine nachparlamentarische Karriere." (Protokoll S. 21f)
Im Rahmen der Feierstunde äußerte die Präsidentin des Bundestages und zweite Bürgerin des Staates einen bemerkenswerten Wunsch. Frau Prof. Dr. Rita Süssmuth beschwor geradezu die Anwesenden:
"Nach dem Motto 'Gemeinsam sind wir stark' wünsche ich mir, dass in dieser Vereinigung (Deutsche Vereinigung für Parlamentsfragen e.V., die den 'Wissenschaftspreis für Arbeiten zum Parlamentarismus' auslobt) eine Auseinandersetzung mit von Arnim stattfindet und dass wir uns stark genug fühlen und nicht der Diskussion ausweichen. Warum sage ich das? Es kann im Pluralismus nicht angehen, dass eine Stimme jeweils dominiert und andere Stimmen nicht gehört werden und dass fast der Eindruck erweckt wird, als hätten wir uns zu verstecken." (Protokoll S. 5)
Ein merkwürdiges Bild: Die zwergenhafte, in einer Ecke zusammengedrängte Volksvertretung in fast aussichtslosem, heroischem Kampf gegen einen unfairen, üblen Riesen. Vielleicht aber hatten die Parlamentarier als die wahre kritische Masse das zahlenmächtige Staatsvolk im Hinterkopf. Aus meiner Sicht sehr schief war auch der Ausklang der Verleihungssitzung am 12.3.1998 mit dem Abspann des Moderators der Veranstaltung, Prof. Dr. Heinrich Oberreuter:
"Kein partizipationsorientiertes System kann sich autonome Politik leisten. Ein solches System kann nur funktionieren, wenn die intermediären Instanzen funktionieren; das heißt, wenn auch die Verbände ihre wichtige Rolle wahrnehmen, Interessen zu artikulieren, Interessen zu transportieren und Interessen zu bündeln, damit sie bearbeitbar sind, und wenn sie zugleich, Herr Spary, gegenüber ihren Mitgliedern die Funktion übernehmen, das, was auf dem politischen Feld ausgehandelt worden ist, auch verlässlich durchzusetzen." (Protokoll S. 37, Hervorhebung von mir)
Das hieße, wenn es einen demokratischen Mehrwert des Verbandswesens belegen sollte: Auf wichtigen Politikfeldern fungieren die Verbände (auch) als ein verdienstvolles Medium zwischen Politik und Bürgern. Bei der völlig offen zugegebenen partikularistischen Zielsetzung bzw. Beauftragung der Verbände hege ich da tiefe Zweifel: Die Verbände und die von den Verbänden gerne in Anspruch genommene Pluralismus-Theorie sagen wohl: Die Vielfalt des Verbandswesens ergäbe - gleichsam automatisch - wieder ein insgesamt ausgewogenes Bild der Gemeinwohlorientierung (vgl. Sebaldt S. 223ff, 239f). Nur: dies ist für die Bürger wegen der sehr geringen Effizienz der Organisation von Bürgerinteressen nichts als schöner Schein. Als zu Beginn der Neunziger Jahre die wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Rahmenbedingungen der deutschen Wiedervereinigung geprägt wurden, saßen die Verbände in der ersten Reihe, nicht die Bürger. Und schon gar nicht die Bürger des Ostens, deren nahe und ferne Zukunft hier gestaltet wurde.
Ganz zum Schluss folgte eine am ehesten wohl selbstberuhigende Presse- und Bürgerschelte des Moderators:
"(Zur Funktion der Demokratie gehört) ein Grundvertrauen in unsere Amts- und Mandatsträger, und auch da, meine ich, ist unsere Kultur nicht auf dem besten und fortschrittlichen Wege. Wenn ich die demoskopischen Daten anschaue, dann hat sich das Vertrauen in die Institutionen und die Amtsinhabern - vorsichtig ausgedrückt - negativ entwickelt. Ich füge hinzu: Daran sind nicht immer die Institutionen und die Amtsinhaber schuld. Ganz im Gegenteil, oft sind es die Interpreten." (Protokoll S. 37)
In der Tat: Viele Bürger halten politische Entscheidungen für durch lobbyistische Einflüsse herbeiführbar, ganz aktuell im Zusammenhang mit der Parteienfinanzierung durch Spenden. Es wird zwar wacker jeglicher kausale Zusammenhang zwischen einer finanziellen Zuwendung an eine Partei und geneigten politischen Entscheidungen bestritten; ich persönlich kenne allerdings niemanden, der dafür die Hand ins Feuer legen würde. Nach dem ZDF-Politbarometer für den Monat Dezember 1999 war die deutliche Mehrheit der Befragten der Auffassung, dass "durch die Spenden Entscheidungen der Kohl-Regierung beeinflusst wurden", 54% ja, 39% nein, 6% weiß nicht. Ende Januar 2000 folgerten laut EMNID bereits 69% der Bürger aus der Entwicklung der Spendenaffäre, Politik sei käuflich (24% nein, 7% weiß nicht; Umfrage für n-tv) - und zwar nun schon ganz allgemein, nicht mehr nur auf die CDU bezogen. Die auslösenden Umstände sind völlig unstreitig nicht die Erfindung oder Übertreibung böswilliger Interpreten. Das Vertrauen einer Demokratie muss sich jeder jederzeit erarbeiten. Sonst sollte er keinen demokratischen Auftrag annehmen.
Big big Bimbes
Zunächst ein Beispiel, bei dem die Fakten klar auf dem Tisch liegen - die Lieferung von Thyssen-Panzern an Saudi-Arabien im Jahre 1991. Hier der Ablauf. Im September 1990 lehnt der Bundessicherheitsrat Waffenlieferungen an Saudi-Arabien zunächst ab und das entspricht auch der Leitlinie, Waffen dieser Art nicht in potentielle Spannungsgebiete zu liefern. Darüber sind sich auch hinsichtlich der Panzerlieferung alle Mitspieler in der Bundesregierung zunächst völlig einig: das Verteidigungsministerium, das Wirtschaftsressort, das Auswärtige Amt und das Kanzleramt (SPIEGEL 48/1999, S. 25). Im Februar 1991 ändert der Bundessicherheitsrat seine Meinung ins Gegenteil und stimmt dem Verkauf nun zu. In das gleiche Jahr fallen Zahlungen in insgesamt mehrfacher Millionenhöhe. Davon leitet der bayrische Waffenhändler Karlheinz Schreiber einen Teil unter Vermittlung des damaligen CDU-Bundesschatzmeisters Walther Leisler Kiep auf ein Treuhand-Anderkonto der CDU, das von dem langjährigen CDU-Steuerberater und Finanzfachmann des Kanzlers Horst Weyrauch eingerichtet worden ist. Von unter anderem diesem Konto aus tätigt die Parteileitung Zahlungen an Parteigliederungen und Einzelpersonen, die im Rechenschaftsbericht der CDU nicht erscheinen. Ein anderer Teil soll unmittelbar an andere der Union nahestehende Personen des öffentlichen Lebens geflossen sein.
Das System der schwarzen Konten, Koffer und Kassen ist zu Beginn des Jahres 2000 schon fast sprichwörtlich geworden. Die drei K der Neuzeit für eine Partei, die nach außen auf Recht, Ordnung und Werte (!) hielt und hält. Teilweise wurden die Finanzströme mit sehr geschmacklosen Legenden und wohlfeilen, aber gefährlichen Klischees getarnt: mit angeblichen Vermächtnissen reicher jüdischer Erblasser an die CDU Hessen. So hat man nach dem Flick-Parteispenden-Skandal viele Millionen noch geschwind vor dem Zugriff des Staates auf sicherem Liechtensteiner Terrain gebunkert, sodann mit pflichtschuldiger Büßermiene das Parteiengesetz verschärft und schließlich - als Gras über die Affäre gewachsen war - Millionen auf "ehrenwerte" Weise zurückgebaggert. Massive Kapitalflucht wegen ur-demokratischer Standortnachteile. Oder: Wasser predigen - Wein saufen. Woher kam der Wein und wohin floss er?
"Er hat mich gelegentlich angerufen und nur gesagt 'Juliane kommt'. Frau Weber erklärte mir dann, dass in diesem oder jenem Parteiverband dieser oder jener Vertrauensmann Kohls unterstützt werden müsse. Frau Weber wartete zehn Minuten, während ich bei Diehl das Geld anforderte."
So beschreibt Eberhardt von Brauchitsch Routinevorgänge aus den siebziger Jahren, also vor Aufdecken des Flick-Parteispenden-Skandals (Der Preis des Schweigens, Propyläen 1999, S. 251). Diehl war der Buchhalter mit dem "wg.". Kohl steht für Kontinuität.
Was waren Ursachen, was waren Folgen? Kann der Einfluss von Parteispenden auf politische Entscheidungen überhaupt im rechtlichen Sinne bewiesen oder widerlegt werden? Realistisch bewertet: Nein. Es ist auch naiv anzunehmen, der im Dezember 1999 eingesetzte parlamentarische Untersuchungsausschusses werde solche Beweise zutage fördern. Mehr als das bereits bekannte zeitliche Zusammentreffen von politischem Meinungswechsel und Geldzahlung wird sich kaum ergeben. Und das ist eben nicht mehr als ein Indiz. Wenn es zwingende Abhängigkeiten gäbe, wären sie nach aller Lebenserfahrung ausschließlich den unmittelbar beteiligten Politikern bekannt. Diese ebenso wie ihre Gegenüber gehörten mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie etwaige Beziehungen zwischen politischen Entscheidungen und Geldleistungen in schriftliche Kontrakte gießen würden. Deswegen sind Barzahlungen, wie sie von Kohl eingeräumt wurden und wie sie in der Folge an den verschiedensten Stellen auftauchten, in diesem Zusammenhang nicht ungebräuchlich.
Bindungswille, Bereicherung und ein Wort zur Ehre
Bei rechtstechnischer Betrachtung gibt es genau besehen in aller Regel noch nicht einmal einen vertraglichen Bindungswillen - ohne dass uns das beruhigen sollte: Wer eine politische Entscheidung herbeiführen will, wird sich hüten, den Wunsch und eine etwa in Aussicht gestellte Belohnung in ein auch nur mündliches Abhängigkeitsverhältnis zu setzen. Bei einem Politiker, der etwas auf sich hält, der Macht verkörpert und der jederzeit seine Ehre verteidigen können muss, wäre dies sogar eine schädliche Strategie - ein völlig unproduktiver Transaktionsaufwand. Das Mittel der Wahl ist vielmehr, die erstrebte Entwicklung darzustellen als schlüssiges Übereinstimmen von Eigeninteresse des Werbers, Gemeinwohl und einem bescheidenen komparativen Vorteil für die politische Gruppierung, die so weise ist, diesen Zusammenhang zu erkennen. Genau so geht ein erfolgreicher nachrichtendienstlicher Führungsoffizier vor, wenn er das Engagement, die Effizienz und die Instrumentalisierbarkeit seines Agenten schaffen und aufrechterhalten will. Der Zeus-hafte Zorn Kohls über die Unterstellung, seine Entscheidungen seien gekauft (genauer: er sei käuflich), ist daher völlig glaubhaft und subjektiv wohl ganz zutreffend. Aus Kohls Perspektive war er jederzeit Herr der Lage. Und genau deshalb war er von großem Nutzen. Adenauer hat die informellen, aber gleichwohl gegenseitig nutzenstiftenden Verbindungen einmal jovial am Kölschen Klüngel erläutert: "Meer kenne us - meer helfe us." Kohl hat am 30.11.1999 gesagt, für ihn "sei in (seinem) gesamten politischen Leben persönliches Vertrauen immer wichtiger gewesen als formale Überprüfungen"; er hat die demokratische Brisanz der Geflechte verdrängt, die ihn genährt haben.
Völlig systemkonform ist dann auch die Lösung, die Kohl im März 2000 seiner CDU anbot - und die sie kaum ausschlagen konnte: Neue Spenden mit sogar einem erklecklichen persönlichen Beitrag, die die vom Präsidenten des Bundestages verhängte Sanktion aufwiegen und neutralisieren. Verstoß ohne Reue für den, der es sich leisten kann, und Grundlage für neue Dankbarkeit und Anerkennung. Was war noch einmal Anwendungsfall der "Notbede"? Ach ja: Auslösung des Landesherrn bei Gefangenschaft.
Gebetsmühlenhaft wird zu allen verdeckten Spenden und zu allen hochrangigen Fürsorgefällen - Flügen, Feiern und Festessen - beteuert, niemand habe sich persönlich bereichert. Rau erklärte beispielsweise, er sei durch seine glänzende Geburtstagsfeier "überrascht" worden. Zwischenfrage: Wer bloß führt die Kalender dieser bedauernswerten, in ihre Termine geworfenen Politiker? Auch zu Kohl heißt es immer wieder, "persönlich habe er doch wohl nichts genommen". Das aber trifft nicht den Kern. Denn selbstverständlich haben sich die Beteiligten die entsprechenden Werte nutzbar gemacht, Rau vielleicht etwas mehr aus hedonistischen Beweggründen und Kohl wegen macchiavellistischer Ziele. Kohl wollte - auch wenn der Bimbes am Ende andere erfreuen sollte - seine eigene Verteilungs- und Verfügungsmacht beweisen. Er wollte zeigen, dass er die Zügel in der Hand hält. Rau und andere, die sich durch Sponsoring Glitz und Glamour auflegen ließen, waren genau auf diese freudige Außenwirkung bedacht, die sie ansonsten aus eigener Schatulle hätten bezahlen müssen, mindestens bei ihren Haushaltsausschüssen hätten begründen müssen. Selbstverständlich war keiner von ihnen mittellos genug, von den Geldern etwas für die private Haushaltskasse abzweigen zu müssen. Alle aber haben sie Leistungen genossen oder in Empfang genommen, die mindestens einen dankbaren Augenaufschlag wert waren. Und die für alle später anstehenden Ermessensentscheidungen vorsorglich in der Waagschale plaziert waren. Das ist typisch für Amigo-Affären aller Zeiten. Um richtig verstanden zu werden: Ich will nicht die Flug-Affäre und die Spenden-Affäre gleichsetzen. Schon wegen Dauer und Volumen des Spendenmissbrauchs ist die manipulative Auswirkung auf die deutsche politische Willensbildung und auch auf die innerparteiliche Demokratie um Größenklassen gefährlicher. Und auf der subjektiven Seite zeigt sich insbesondere in reueloser Wiederholung und ausgeklügelter Tarnung eine bestürzende rechtsfeindliche Energie. Aber es zeigt sich auch eine verbindende Basis: die unbekümmerte Selbstverständlichkeit, mit der das Geld anderer Leute in eigene Privilegien, Jet-Lechz und Macht umgesetzt wird. Und dies ist letztlich das Geld der Bürger, seien es Mittel staatlicher Unternehmen, seien es hintertriebene Steuern oder erschlichene staatliche Parteifinanzierung.
Kraftvolle Triebfeder der ganz gewöhnlichen, der genusssüchtigen Korruption ist ein in die Demokratie eingebauter Bruch und Neidfaktor, bekannt übrigens auch in autoritären Staatsformen. Es ist der Tribut der Demokratie an die Lebenswirklichkeit: Da sind einerseits die Spitzen des Staates, die formell Machtreichen. Und es gibt die praktisch einflussreichen Eliten, die Reichtumsmächtigen. Beide Seiten sind in einer Art Hassliebe aneinandergekettet: Sie brauchen einander und sie schielen auf das jeweilige Kapital ihres Partners, auch wenn sie ihn selbst nicht unbedingt respektieren.
Ach, und die persönliche Ehre, mit der Kohl Aufklärung verweigert! Was ist überhaupt ein Ehrenwort? Ein Ehrenwort ist eine Form der besonderen Bekräftigung, das Versprochene zu verwirklichen. Das Ehrenwort gibt das eigene Ansehen zum Pfand und gleicht Formeln wie "bei allem, was mir wert ist" oder "beim Leben meiner Mutter" oder, etwas schwächer: "ein Mann - ein Wort". Versehen mit offiziellen Sanktionen nutzt der Staat die Bindungswirkung dieser formelhaften Verstärkungen bei Eiden, Fahneneiden und Schwüren. Das Kennzeichnende aber ist die Gruppenbezogenheit einer solchen Bekräftigung; dazu ein simpler Fall:
In einer Gruppe von Halbwüchsigen gibt einer sein Ehrenwort, nachts das Kreuz vom Kirchturm zu holen. "Machst du nicht!" "Und ob ich das mache!" "Ich glaub dir kein Wort!" "Ehrenwort, ihr werdet schon sehen!" Dies hat sehr konkrete Wirkungen innerhalb der Jugendgang: Bei einer fiktiven Gerichtsverhandlung innerhalb der Gruppe könnte der Fehlschlag vorgeworfen, vielleicht sogar geahndet werden. Gelingt der Plan, sind Anerkennung, Loyalität und gfs. Gegenleistung sicher. Beurteilen hingegen Pfarrer, Polizist oder Richter den gleichen Sachverhalt, ist die gruppeninterne Bekräftigung keinerlei Entschuldigung: Das Verhalten wird schlicht an der allgemeinen Rechts- und Sittenordnung gemessen. Und unser Halbstarker wäre wohl sehr irritiert, wenn sein Ehrenwort beim Pfarrer, Polizisten oder Richter Eindruck schinden würde.
Genau so ist es auch hier. Darum gehen Rechtfertigungsversuche fehl, die der wackere Pater Basilius Streithofen zu Kohls Verteidigung unternommen hat - in rhetorischer Verkürzung der kirchlichen Morallehre. Die Rechts- und Moralordnung schützt kein ihr entgegen gerichtetes Ehrenwort, sondern belässt das Risiko des Ansehensverlustes bewusst bei dem Versprechenden. Sonst gäbe sie sich auf. Die Ehre der Prizzis bleibt die Ehre der Prizzis. Ich halte nebenbei für die derzeit wahrscheinlichste Erklärung: Das Ehrenwort ist nur eine Kulisse, die den tatsächlichen Geldfluss verdecken soll. Denn gäbe es ehrenwerte und rational handelnde Spender, müssten Sie den politischen Flurschaden - Erosion der ihnen verbundenen Volkspartei - als entscheidend größer bewerten als das Beharren auf Anonymität. Und das gälte selbst dann, wenn es sich um nachzuversteuernde schwarze Gelder gehandelt hätte.
Kaltes und ungewaschenes Geld für die Parteien
Wie kann der Einfluss partikulärer Interessen bei der Parteifinanzierung gemindert werden?
Da die Einflussnahme auf die politische Willensbildung der Parteien zwar in psychologische, aber nur im Ausnahmefall in juristische Schablonen passt, kann man sie auch durch formale Offenlegung von Spendenzahlungen nie verlässlich in den Griff bekommen - und seien die Rechenschaftsberichte noch so akribisch aufgestellt. Der darauf gerichtete Vorschlag Gerhardts erscheint mir daher nicht geeignet, das durch die Reihe von Spendenskandalen lädierte Vertrauen der Bürger wiederherzustellen.
Man kann die Einflussnahme aber weitestmöglich zurückdrängen. Ein derzeit vorgeschlagener Weg ist, Spenden juristischer Personen (Firmenspenden) völlig auszuschließen. Dies hätte eine tiefe demokratische Logik, da juristische Personen mit ihren Zuwendungen in den Prozess der politischen Willensbildung eingreifen, selbst jedoch weder aktives noch passives Wahlrecht besitzen. Auch bei der Beschränkung auf natürliche Personen blieben allerdings vielfältige Umgehungswege und ohnehin bestünde der Vorwurf weiter, dass große Vermögen ein eigennütziges Profil der politischen Landschaft fördern könnten und ihre Besitzer im demokratischen Sinne "gleicher wären als andere".
Daher erscheint mir als sauberste Lösung diejenige, die Heiner Geißler vorschlägt: Die Finanzierung der Parteien wird vollständig auf Leistungen des repräsentierten Volkes umgestellt, also auf staatliche Förderung. Dabei kann unter Berücksichtigung von Mitgliederzahl und aktuellem Wählerpotential angemessene Chancengleichheit gefördert werden, deutlich ausgewogener als unter dem derzeitigen Spenden-Regime.
Gegen die Eindämmung des Spendensegens erheben sich reflexartige Bedenken: Die bisher gewohnten Wahlkämpfe wären nicht mehr zu finanzieren, sagt Inge Wettig-Danielmeier, SPD. Das sehe ich gelassener. Die Wahlkämpfe heutiger Prägung mögen im besonderen Interesse der beteiligten Agenturen liegen - und diese gehören zu einem aufstrebenden, selbstbewussten und politiknahen Zweig der Werbebranche. Eine Gefahr für den Bürger und die inhaltliche Akzentuierung von Politik erkenne ich allerdings überhaupt nicht. Mangels unterscheidbarer Schwerpunkte in der politischen Mitte hatte sich die Wahlwerbung der vergangenen Jahre ein gegenseitiges Wettrüsten in Aufwand und Form geliefert - ganz analog der sprichwörtlichen Waschmittelwerbung. Wenn wir in Zukunft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden, erscheint mir das hilfreich; allerdings müssten die Parteien dann verschärft über Konzeptionelles und Konkretes und über Schnittstellen zum Bürger nachdenken. Was nicht schaden kann.
Gleichzeitig muss die Unbestechlichkeit der Politik auch in der Rechts- und Strafordnung als grundlegender Wert hervorgehoben werden: Bestechlichkeit und Vorteilsannahme sollten gerade an der Spitze des Staates - bei Parlament und Regierung - Straftaten sein, und nicht nur bei den ausführenden Organen. Auch Verstöße gegen das Parteiengesetz dürfen nicht länger lässliche Sünden sein, nicht bloße Kavaliersdelikte. Der Rechtsstaat muss die Funktionselemente der Demokratie wehrhaft und mit den bewährten Werkzeugen und Einrichtungen schützen, die uns Bürger von Diebstählen und Betrügereien abschrecken.
Ein weiterer Schauplatz der Spendenaffäre ist die innerparteiliche Demokratie, die Frage, ob und wie durch Zweckentfremdung von Geldern intensive Parteipolitik betrieben wurde. Ich möchte die beiden Komplexe nicht in ein Rangverhältnis setzen - einerseits die mögliche Manipulation staatlicher Entscheidungen durch demokratisch nicht legitimierte Gruppen und andererseits ein etwaiges Parteiregime durch Geldzahlungen. Aber ich möchte vor einer sehr naheliegenden Gefahr und einer typisch deutschen Schwäche warnen: Dass nämlich der Untreue-Vorwurf gegen Altkanzler Kohl zur Personalisierung dient und dass mit der Bestrafung eines prominenten Sündenbocks der strukturelle Mangel der deutschen Demokratie überdeckt und ausgeblendet wird. Das Kernproblem bliebe dann unaufgearbeitet.
Bürgerorientierung und Antwortbereitschaft: Ein Selbstversuch
Ein kleiner persönlicher Diagnoseversuch zur Bürgerorientierung von Staat/Politik vor der 1998er Wahl: Meine Frau und ich haben alle Vorstandsmitglieder der Bundestagsfraktionen ermuntert, im Wahlkampf nicht nur eigene Positionen zu verlauten, sondern die thematische Kommunikation betont zweiseitig anzulegen und die Bürger aktiv aufzufordern, konkrete eigene politische Wünsche an die Parteien zu richten. Kurz: die Parteien sollten einen betont "responsiven", einen antwortbereiten Wahlkampf führen. Zum Begriff: Responsivität ist im amerkanischen Verfassungsrecht selbstverständlich. Staat und Regierung müssen "responsible and responsive" sein - gerecht sein und ein offenes Ohr für die Bürger haben. Siehe unser Schreiben.
Parallel hatten wir die Mitglieder der Auswärtigen Ausschusses und des Verteidigungsausschusses angeschrieben und dort eine themenbezogene Bitte angebracht: die Frage der gesetzlichen Regelung der Aufgaben der Bundeswehr im Wahlkampf zu behandeln (dazu das zweite Schreiben).
Zunächst eine Übersicht über die Ergebnisse
Demokratisierung des Wahlkampfes (an: Vorstände der Bundestagsfraktionen)
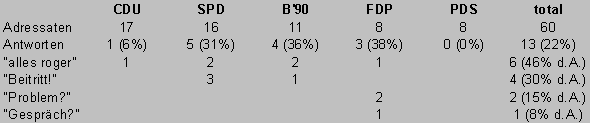
Die Zeilenbezeichnungen bedeuten:
Adressaten : Zahl der angeschriebenen Abgeordneten
Antworten : Rückläufe ohne Zählung reiner Abgabenachrichten
"alles roger" : Die Partei tut schon was sie kann
"Beitritt!" : Parteibeitritt, dann auch effizienter Einfluss
"Problem?" : Nachfrage, ob konkreter eigener Vorschlag
"Gespräch?" : Angebot eines persönlichen Gesprächs
Regelung Bundeswehraufgaben (an: Mitgl. Auswärtiger Ausschuss / Verteidigungsausschuss)
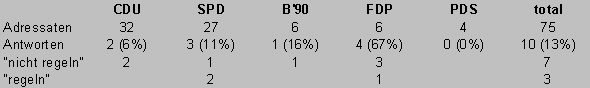
Die zusätzlichen Zeilenbezeichnungen bedeuten:
"nicht regeln" : keine gesetzliche Regelung erforderlich
"regeln" : gesetzliche Regelung sinnvoll / wird angestrebt
Gesamt
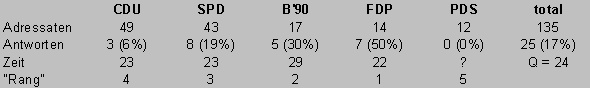
Die zusätzlichen Zeilenbezeichnungen bedeuten:
Zeit: durchschnittliche Antwortzeit (Tage)
Rang: Rangfolge der Parteien (primär Antwortquote, sekundär Antwortzeit)
Eine kurze Auswertung der Ergebnisse und Erlebnisse
Zu Anfang eine kleine Überraschung: die Antwortbereitschaft der PDS war trotz basisdemokratischer Elemente des Wahlprogramms gleich Null, sowohl bei dem Thema Demokratisierung des Wahlkampfes als auch bei der Frage einer gesetzlichen Regelung der Bundeswehraufgaben. Direkt auf den nächsten Rang kommt die CDU/CSU, die an einem Austausch zu beiden Themen gleichmäßig wenig interessiert erschien (6%), dann folgen mit ansteigender Aktivität die SPD (19%), die Bündnis-Grünen (30%) und als Sieger die FDP mit 50% Reaktionsbereitschaft.
Interessante Details
Die SPD drückte beim Demokratie-Thema in zwei Antworten aus, bei ihr sei alles schon super oder zumindest so gut wie möglich, und in drei weiteren Antworten, dass für einen inhaltlichen Input ein Parteibeitritt sehr hilfreich sei (zur Erinnerung: Thema war die Einbeziehung nicht organisierter Bürger). Eine dieser drei Antworten erhielt unseren Sonderpreis für skurrile Rhetorik: Mit unserem Beitritt könnten wir die Schlagkraft der SPD zum Eingehen auf Bürgerwünsche entscheidend erhöhen! Zum Vergleich:
Sie stehen samstags gegen Mittag schon eine Stunde in der Kassenschlange des Supermarktes an und wenden sich schließlich erregt an den Niederlassungsleiter. Dieser aber verkündet Ihnen mit seinem gewinnendsten Lächeln, er habe eine Stelle frei und Sie könnten sogleich eine neue Kasse aufmachen. Na ja!
Quer durch einige Antworten läuft ein deutliches Missverständnis:
Die Abgeordneten würden sich doch bekanntermaßen ständig mit einer großen Zahl von persönlich an sie herangetragenen Bürgerwünschen herumschlagen und seien daher schon immer sehr responsiv.
Gemeint ist die Flut von petitionsähnlichen Eingaben der Bürger bei "ihren" Abgeordneten. Nun: Das ist nichts im demokratischen Sinne Aufregendes. Es ist dies das alte Handlungsmuster, durch Einschalten einflussreicher - und mit Verlaub: ihrerseits an Wiederwahl interessierter - Personen eigene Probleme mit einem kleinen Vorsprung zu richten (z.B. Arbeits- und Ausbildungsplätze, Bau- und sonstige Genehmigungen etc.). Es geht bei diesen Eingaben nur ausnahmsweise darum, generelle Regelungen voranzubringen.
Mehrfach stöhnten Abgeordnete über fortgesetzt schlechte Erfahrungen mit den "fürchterlich trägen Bürgern":
Man könne sich auf den Kopf stellen und mit den Beinen Fliegen fangen. Niemand interessiere sich dafür und an solchen Bürgern könne man nun mal schnell das Interesse verlieren!
Aber: Selbst wenn das so wäre und bei allen Themen so sein müßte (schon dies bezweifele ich), so wäre dieses Verhalten doch von einem obrigkeitlichen Demokratie-Verständnis über Jahre eingeübt und die Politiker wären die ersten, die den Prozess umkehren könnten. Zudem: Wenn Bürger die Politik wachküssen, versteht der Staat das meistens als Aufstand.
Beim Demokratie-Schreiben hätte denn auch folgende Rückfrage der Adressaten nahegelegen: ob wir auch ein bestimmtes thematisches Anliegen hätten. Darauf aber kam niemand bei der CDU, niemand bei der SPD, einer bei den Bündnis-Grünen und zwei bei der FDP. Eine dieser FDP-Abgeordneten war sogar so neugierig, ein persönliches Gespräch zu wagen. Herzlichen Glückwunsch, Ina Albowitz: Spiel, Satz und Sieg!
Infolge der nachfolgenden politischen Entwicklung erscheint heute die (eine) Reaktion der Bündnis-Grünen zur gesetzlichen Regelung der Bundeswehraufgaben bemerkenswert: man sei gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr, da werde man doch nicht noch auf eine gesetzliche Regelung hinwirken. Nach Jugoslawien müssten sich die Bündnis-Grünen konsequenterweise grundlegend neu besinnen; gehört haben wir davon allerdings nichts.
Kurz noch zur Reaktionszeit: Bei der PDS (keine Antwort) wäre Null so falsch wie unendlich; also: zwischen heute und der Ewigkeit (eine kleine Ehrenrettung: auf unseren Aufruf zur Beendigung der Bombardierung Jugoslawiens hat die PDS binnen 14 Tagen reagiert). Die durchschnittliche Antwortzeit der Bündnis-Grünen betrug 29 Tage, der CDU und der SPD 23 Tage und der FDP 22 Tage.
135 Schreiben und 23 Antworten sind keine optimale Bewertungsbasis, ganz klar. Aber Trends sind gleichwohl bemerkbar: Die PDS und besonders die Volkspartei CDU sollten bei der Behandlung von Bürgeranliegen noch nachlegen (Anmerkung zur CDU: die Unterschriftenaktion zur doppelten Staatsangehörigkeit und die etwaige Briefkampagne zur Rentensicherheit sind vielleicht innovativ, aber nicht responsiv: die Unterschriftenaktion hatte eine vorgegebene Richtung und eine Gegenmeinung wurde nicht abgefragt; und die Rentenkampagne folgt völlig dem in der Politik gewohnten top-down-Informationsschema). Die großen Parteien einschließlich der SPD scheinen in einem eigenen politischen Kosmos zu leben, der mit ambitionierten Mitgliedern, Beratern und Interessengruppen jeweils autark lebensfähig ist. So hörten wir etwa aus der SPD:
"Auf Veranstaltungen zu ganz unterschiedlichen Themen sind Politikerinnen und Politiker des SPD mit jungen Nachwuchskräften aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammengetroffen und haben einen intensiven Meinungsaustausch gepflegt."
Faszinierend. Und in einer anderen Antwort:
"Die Vorschläge von Außenseitern sind gegenüber denen, mit denen wir schon seit längerem enger zusammenarbeiten, und die unsere politische Philosophie von diversen Briefings her gut kennen, in gewissem Nachteil."
Auf uns wirkt das mächtig eng - wie in einer Konserve. Etwas anders sieht es offenbar bei der FDP aus - wobei auf den ersten Blick deren etwas größere Interaktionsfähigkeit durch die aktuellen Wahlergebnissen nicht bestätigt zu werden scheint. Aber vielleicht hat die FDP schon die Zeichen der Zeit erkannt und sich auf die bürgerlich-liberalen und wachsam bürgerschützenden Wurzeln besonnen. Ich wünsche hierbei - der FDP wie allen anderen Parteien - gutes Gelingen.
Noch eine kleine Auffälligkeit zum Schluss: Auch dort, wo wir Antworten bekommen hatten, war damit dann der Kontakt immer schlagartig "abgearbeitet" und beendet; es gab in der Folge nicht etwa Hinweise auf thematisch einschlägige Aktionen oder Veranstaltungen der jeweiligen Partei. Selbst impertinentes Bürger-Interesse ist offenbar nicht interessant genug. Oder die Parteien investieren ganz praktisch nicht die Ressourcen, um Demokratie lebhaft auszufüllen.
Reform-Stau nur in der Verwaltung?
Die Politik fordert schon lange den "schlanken Staat" oder seit 1998 den "aktivierenden Staat" und im Internet wird aufgerufen: Deutschland erneuern! Gemeint ist: Die Verwaltung soll sich den Bedürfnissen der Kunden (der Bürger) öffnen, Verantwortung und Autonomie an die Bürger zurückgeben und dabei effizienter werden. Das ist richtig. Umso richtiger ist aber: intensivierte Bürgerkommunikation ist eine essentielle Forderung auch an die Politik selbst und an die politischen Parteien, die das Kernelement der politischen Willensbildung sind.
Die Parteien müssen aktiv auch Nicht-Organisierte einbinden. Und es darf keine unrealistischen Hürden geben: der durchschnittliche Bürger wird vielleicht weniger Mühe als ich aufbringen, um Antworten aus der Politik herauszuquälen. Einem bürgerorientierten Staat stehen auch neue Instrumente wie ein politisches Initiativrecht und auch Entscheidungsrecht auf Bundesebene (Volksbegehren und Volksentscheid) gut zu Gesicht. Und auch die Wahl ihres Staatsoberhauptes braucht den Bürgern nicht länger vorenthalten zu bleiben. Frankreich wagt so viel Demokratie schon seit Jahrzehnten - sogar bei einem deutlich machtvolleren Präsidentenamt! Und Frankreich hat die Präsidentenwahl ganz direkt-demokratisch eingeführt, nämlich per Volksentscheid (dabei ist der kleine Schönheitsfehler, dass das Referendum von de Gaulle auch aus höchsteigenem Interesse angeschoben worden war, durch Generationswechsel inzwischen bedeutungslos geworden).
Zur Bürgerorientierung der Parteien meine Thesen und ein Markt-orientiertes Leitbild und zum Thema Demokratie-Entwicklung und demokratische Defizite ein paar Leserbriefe.
Ist Demokratie objektivierbar oder messbar?
Es ist ein lohnender Auftrag für die Staatsrechtswissenschaft: Prüfsteine für eine vergleichende Bewertung der Effizienz von Demokratien zu entwickeln. Es würde dazu beitragen, Schwachstellen aufzuzeigen und Reform-Prioritäten zu definieren.
Das aus dem Begriff "Demokratie" oder "Herrschaft des Volkes" abgeleitete Ziel scheint klar: In unserem Staat soll das Volk sein eigener Herr sein (Stein in: Alternativkommentar zum Grundgesetz, 2. Aufl. 1989, Art. 20 Abs. 1-3, Rdnr. 9). Aber ist es das im wirklichen Leben? Was ist Fassade, was ist Struktur?
Ein erstes Gerüst für einen solchen Demokratie-TÜV finden Sie hier. Eine Fangfrage dazu: Ist Wohlstand ein Gradmesser von Demokratie?
Das Jahr-1999-Problem: auf dem Weg zum Demokratie-GAU?
Mündet die Demokratie-Krise in einen katastrophalen Demokratie-GAU? Sehr unwahrscheinlich: Weil derzeit keine fundamentalen materiellen Probleme drohen, weil wir 1933-1945 schon mitgemacht und zum Glück noch bestens im Gedächtnis haben und weil auch der erbitterte Streit um Weltanschauungen bis zu einem einstweiligen historischen Ende ausgefochten ist.
Nein, unserer Demokratie droht nicht der (umstürzlerische) Hitzschlag, wie er noch Hermann Ehlers in seiner oben zitierten Antrittsrede als Bundestagspräsident im Jahre 1953 vor Augen gestanden haben mag. Eher droht der langsame Kältetod. Wer kosmologische Modelle mag: Das Gemeinwesen ist nicht auf dem Weg zu einer Supernova, sondern vewandelt sich in einem schleichenden Prozess in einen weißen, grauen und dann schwarzen und kalten Zwerg. Die Wahlbeteiligung geht in der langfristigen Tendenz kontinuierlich zurück. Trotz der gestrengen - eigentlich: flehenden - und gebetsmühlenhaften Ermahnungen der zu Wählenden, Wahl sei Demokraten-Pflicht. Dabei ist dieser Prozess im besten Sinne evolutiv, Verhaltens-ökonomisch und Markt-konform: Lebendiges tut bevorzugt das, was ihm unmittelbare Rückkopplung im Sinne fühlbaren Nutzens bringt. Rituale und hospitalistische Ticks sind eher Zeichen erfolgreicher Fremdbestimmung oder einer psychischen Störung.
Die weitere Entwicklung? Polit-Profi wird zunehmend, wer dies als persönliche Karriere-Chance ansieht. Gemeinsinn-orientierte Bürger werden sich weiter abwenden. Viele politische Talente werden effizientere Aktionsfelder suchen - in der Wirtschaft, in supranational operierenden Organisationen oder ganz im Gegenteil in zutiefst lokalen Gegen-Welten - und den schrumpfenden Staat nach Kräften alt aussehen lassen. Sie werden sich ihre Erfolgserlebnisse ohne oder gar gegen den Staat verschaffen.
"Demokratur!" knurrt höchst ungnädig ein Mann aus der Nachbarschaft. Dieser Bürger - bolzengerade hätte man den Typus früher genannt - organisiert seit Jahren engagiert, kompetent und ganz ohne Staatsmittel ein weit über die Gemeindegrenzen hinaus attraktives Kulturprogramm. Und er ist noch dazu ein hoch-effizienter Katalysator für das Stadtbild, für nachbarschaftliches Leben und für die Denkmalpflege. Den naheliegenden Bundes- oder Landesorden lehnt er als persönliche Beleidigung ab. Für ihn ist ein solcher Orden Talmi, mit dem der Staat nicht zuletzt auch eigene Funktionsträger "dekoriert". Solche, die ohne persönlichen Mut, teils ohne Kreativität und ohne jedes wirtschaftliche Risiko die Aufgaben administrieren, für die sie bezahlt werden - manchmal auch als dienendes und zusätzlich zu belohnendes Element eines Dankbarkeitsgeflechts.
Unser Staat müsste an dem oben genannten Bürger interessiert sein, als an einem leuchtenden Vorbild für bürgerliche und bürgernützende Tatkraft. Hingegen ist dieser Staat wohl froh über jede Minute, in der er sich nicht mit dem Mann befassen muss. Die grauen Verwalter tun die nervigen Querdenker gar zu gerne als bloß querulatorisch ab - Kohlhaas, Räuber Mohr, Gandhi, Ende's Momo, Hundertwasser, Biedenkopf und eben den beschriebenen Bürger. Aber gerade das beharrliche Querdenken macht Reform möglich und verhindert den Kältetod.
Kann man Querdenken nicht zum Vorschul-, Schul- und Studienfach machen? Undenkbar? Eben!
Gesundheit!
Also: ein Demokratie-GAU droht derzeit wohl nicht. Nur ist es ein sehr menschliches Problem, Gefahren bevorzugt mit plötzlichen Ereignissen, mit Unfall, Knall und Krach zu verbinden. Für die graduellen Übergänge fehlt uns die Antenne. Das hat intensiv mit den Strategien zu tun, die wir seit Tausenden von Jahren zur Bewältigung unserer komplexen Umwelt einsetzen. Wir reduzieren Unübersichtlichkeit durch eher digitale als analoge Wahrnehmungstechniken: Wir erkennen Ergebnisse ("das, was hinten rauskommt") besser als Prozesse, setzen eher auf Köpfe als auf Ideen, sammeln lieber Dinge als Bewertungen, mögen Haltung, Position und Bekenntnis eher als die Analyse.
Aber das Leben selbst und die Prozesse in Gemeinschaften sind analog, nicht digital. Ein sehr beeindruckendes Bild hat Thomas Stearns Eliot mit seinem Gedicht "The Hollow Men" geliefert. Hinweis auf der Packungsbeilage: Lesen nur an hellen Tagen. Interessant ist hier insbesondere das Ende der "Hollow Men", das ich vor vielen Jahren als Vorwort in Nevil Shute's Roman "On the Beach" gelesen hatte. Auch da ging es um einen schleichenden Übergang.
Wir sollten nicht auf einen Knall warten, sondern jetzt Heilungsprozesse einleiten und auf Dauer anlegen. Gesundheit eines Organismus ist nicht die schlichte Abwesenheit von Krankheit; Gesundheit verdanken wir der kontinuierlichen aktiven Arbeit der gesundhaltenden Immunsysteme. Weniger als ein Zustand ist Gesundheit ein Prozess. Das gilt völlig übereinstimmend für Organisationen und Gemeinschaften. Auch sie bleiben in guter Funktion nur durch andauernde bewusste Prüfung und Reaktionsfähigkeit.
Zum Immunsystem der Gemeinschaft gehört nicht nur die Opposition. Die Opposition teilt viele Interessen mit der Regierung, auch den unerschütterlichen Glauben an die eigene Regelungskompetenz und die unheilvolle Neigung, schon im Angesicht des Scheiterns eines Projektes noch "mehr vom Gleichen" für dessen Realisierung zu verlangen. Der Effekt, den Paul Watzlawick sehr unterhaltsam beschrieben hat, führt zu einer doppelten Blindheit:
"Erstens dafür, dass die betreffende Anpassung (Bezug: eine früher sinnvolle Überlebensstrategie, es gilt aber ebenso für alle Projekte und Pläne) eben nicht mehr die bestmögliche ist, und zweitens dafür, dass es neben ihr schon immer eine Reihe anderer Lösungen gegeben hat, zumindest nun gibt. Diese doppelte Blindheit hat zwei Folgen: Erstens macht sie die Patentlösung immer erfolgloser und die Lage immer schwieriger, und zweitens führt der damit steigende Leidensdruck zur scheinbar einzig logischen Schlussfolgerung, noch nicht genug zur Lösung getan zu haben. Man wendet also mehr derselben "Lösung" an und erreicht damit genau mehr desselben Elends." (Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein, Piper, 16. Aufl. 1997, S. 28f). Was wiederum das Verbrämen, Vertuschen und Weiterweisen politischer Flops in den Rang einer besonders blühenden Kunst erhoben hat.
Zum Immunssystem gehören daneben auch nicht nur die Gerichte. Die Gerichte sind auf einschlägige Gesetze und auf Kläger angewiesen, sonst beißen sie nicht.
Das Immunsystem ist auch mit den Medien noch nicht vollständig. Die Medien leben teils in einem intensiven Austauschverhältnis mit der Politik - politische Insider-Information gegen Werbung für die Insider und ihre Projekte - sie leben auch in Symbiose mit der Wirtschaft, sind selbst Teil der Wirtschaft. Praktisch alle Medien haben zudem eine mehr oder weniger offen sichtbare politische Heimat - in der Sprache der Mitbestimmung heißen sie denn auch Tendenzbetriebe.
Zum Immunsystem gehören darum insbesondere die Bürger, möglichst viele wache, informierte und demokratisch engagierte und kompetente Bürger. Die Wettbewerbsfähigkeit der Bürger bei der politischen Willensbildung und ihre nachhaltige Motivation sind eine direkte Funktion der Rechte und der Beteiligung, die sie eingeräumt bekommen. Man und frau wächst - oder schrumpft - mit seinen/ihren Aufgaben. Felix von Cube und Dietger Alsguth haben 1986 ein gutes Buch über pädagogische Strategien geschrieben. Es heißt "Fordern statt verwöhnen!"
Das ist es. Wir Bürger bitten, endlich gefordert zu werden. Wir fordern es sogar.
Ganz aktuell tut sich etwas - für mich durchaus überraschend. Auf diese Homepage hingewiesen haben mir zwar die Abgeordneten der CDU praktisch durchgängig geantwortet, es bestehe "kein Anlass, am System der repräsentativen Demokratie zu rütteln"; "direkte Demokratie leiste der Demagogie Vorschub und ermögliche keine Kompromisslösungen"; auch sei gerade die derzeitige "Parteispenden-Diskussion ein eindrucksvoller Beweis für Transparenz und Funktionsfähigkeit des Gemeinwesens". Aber gleichzeitig wirbt die CDU im Landtagswahlkampf NRW mit der folgenden Anzeige:
Auf die Frage, ob die Bürgerinnen und Bürger mehr Möglichkeiten haben sollen, in der Politik mitzuentscheiden, haben geantwortet:
stimme zu: 87%,
lehne ab: 11%.
Jürgen Rüttgers fordert: 'Mehr Beteiligung der Bürger.'
(als Quelle genannt: EMNID, NRW-Tracking Umfrage vom 27.1.2000)
Ich freue mich auf die Umsetzung.
Schon höre ich aber, das wäre gar nicht so gemeint gewesen. Für die "richtige" Politik auf Bundesebene gebe es in der Regel keine einfachen Lösungen, hier eigne sich das "Ja/Nein" der Volksabstimmung nicht. Hier müsse im parlamentarischen Verfahren im gegenseitigen Geben und Nehmen und in vielfältigen Kompromissen erst der beste Weg gefunden werden. Es verblüfft, dass gerade diejenige Partei den politischen Kompromiss als zwingende Voraussetzung der optimalen Lösung verkauft, deren demokratische Willensbildung und deren Immunität gegen die Einflüsse Dritter heute am ehesten in Zweifel stehen. Und die die Regierung jederzeit auf tatsächliche oder angebliche "Flickschusterei" hinweist. Die CDU blendet auch einen ganz wesentlichen Gewinn der Bürgerbeteiligung aus, der vom konkreten Ergebnis eines Gesetzgebungsprojekts völlig unabhängig ist: den Kompetenzgewinn der Bürger im Verlauf eines einzigen Projektes. Man kann ihn an einem Schweizer Beispiel sehr plastisch beschreiben:
Vor wenigen Jahren wurde in der Schweiz ein Volksbegehren angestoßen, das auf Abschaffung der Schweizer Miliz hinauslief. Selbst Befürworter der direkten Demokratie zweifelten zunächst am Geisteszustand des Initiators. Zu Recht wiesen sie darauf hin, mit gleicher Erfolgsaussicht könnte man im Vatikanstaat den Papst zur Disposition stellen. Die Schweizer lehnten dann auch mit klarer Mehrheit den Antrag ab. Aber bis zur Abstimmung entfaltete sich eine intensive und qualitativ hochstehende Diskussion um die konkreten aktuellen Aufgaben der Bundesarmee, die - bis in Straßenbahnen, Wirtschaften und Familien - engagiert und differenziert ausgetragen wurde. Am Ende konnte der Etat des Schweizer Militär um ein Drittel gemindert werden - auf der Grundlage gemeinsamer neuer Ziele.